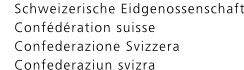«Sicherheitspolitik ist eine Verbundaufgabe par excellence»
Angesichts der zunehmenden Instabilität und Bedrohungen weltweit hat die Schweiz ihre Sicherheitspolitik verstärkt und ein Staatssekretariat als Kompetenzzentrum für Sicherheitspolitik und Informationssicherheit geschaffen. Ein Gespräch mit Markus Mäder, der das Amt seit dem 1. Januar 2024 leitet.
Die Sicherheit ist auch für ein neutrales Land wie die Schweiz zu einem strategischen Thema geworden. Welches sind heute die wichtigsten geopolitischen Herausforderungen für die Sicherheitspolitik der Schweiz?
Wir befinden uns in einer geopolitischen Umbruchphase. Deren Auswirkungen haben auch das strategische Umfeld der Schweiz erfasst. Auf regionaler Ebene ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine die unmittelbarste sicherheitspolitische Herausforderung. Die russische Aggression gegen einen souveränen Nachbarstaat ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts, insbesondere der UNO-Charta, und destabilisiert die gesamte europäische Friedens- und Sicherheitsordnung. Dies verdeutlicht auch, dass die Anwendung roher militärischer Gewalt als Instrument der Interessendurchsetzung wieder auf dem Vormarsch ist – eine Entwicklung, die nach Jahrzehnten des Friedens auf unserem Kontinent von vielen zumindest im europäischen Kontext für unmöglich gehalten worden war.
Über das unmittelbare Geschehen in der Ukraine hinaus beobachten wir eine wachsende hybride Konfliktführung Russlands gegen Europa mittels Beeinflussungskampagnen, Desinformation, Cyberangriffen, Spionageaktivitäten und Sabotageaktionen. Betroffen sind insbesondere Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen. Aber im Informations- und Cyberraum ist auch die Schweiz bereits tangiert, sowohl als Austragungsort wie auch als Ziel. Die Grenzen zwischen Frieden und bewaffnetem Konflikt sind mittlerweile uneindeutig und verschwommen.
Auch auf globaler Ebene beobachten wir besorgniserregende Entwicklungen. Weltweit verschärfen sich Spannungen und brechen neue Konflikte aus – sei dies im Rahmen der Systemkonkurrenz zwischen Grossmächten wie auch in direkten Konflikten zwischen Regionalmächten und innerhalb von Staaten. Die regelbasierte internationale Ordnung mit ihrem System kollektiver Sicherheit, das sich als Folge des Zweiten Weltkrieges mit der Absicht zur Verhinderung von weiteren Kriegen herausgebildet hatte, zeigt Anzeichen einer anhaltenden Erosion. Multilaterale Konfliktlösungsmechanismen und internationale Abkommen, wie beispielsweise solche zur Rüstungskontrolle, verlieren an Wirksamkeit und Unterstützung. Es findet ein Ringen um die künftige Ausgestaltung der internationalen Beziehungen statt, wobei offensichtlich unterschiedliche Konzepte zur Weltordnung bestehen. Ganz grob kann man sagen: die freiheitlich-demokratischen Staaten haben ein Interesse am Erhalt der gegenwärtigen regelbasierten Ordnung, während eine Gruppe autoritärer Mächte eine Revision in ihrem Sinne verfolgt und etliche andere Staaten zumindest eine Reform des herrschenden «Regelwerkes» anstreben. Mit der eingeleiteten Neuausrichtung der amerikanischen Aussen- und Sicherheitspolitik unter Trump 2.0 wird diese internationale Ordnung weiter geschwächt; dies hat auch fundamentale Auswirkungen auf das transatlantische Verhältnis und die europäische Sicherheit, womit die Schweiz unmittelbar betroffen ist.
Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass auch nichtstaatliche Gewaltphänomene und Akteure unsere Sicherheit weiterhin bedrohen: Terrorismus, gewalttätiger Extremismus sowie organisierte Kriminalität. Und der Klimawandel wirkt als allgemeiner Konflikttreiber, da er Ressourcenknappheit, Armut und Migration verstärkt und somit bestehende sicherheitspolitische Risiken erhöht.
Ich bin überzeugt, dass wir angesichts der Vielschichtigkeit und Komplexität der heutigen Bedrohungen das Zusammenwirken unserer zivilen und militärischen Abwehr- und Reaktionsfähigkeiten weiter ausbauen und entwickeln müssen. Letztlich liegt die Stärke der schweizerischen Sicherheitspolitik im Verbund, im Einbezug aller relevanten Partner. Das ist unsere bewährte eidgenössische Vorgehensweise, und diese Stärke müssen wir pflegen und weiterentwickeln.
Die nationale Sicherheit beruht oft auf einer Kombination aus militärischen und zivilen Mitteln. Bleibt es für die Schweiz immer noch relevant?
Sicherheitspolitik ist eine Verbundaufgabe par excellence. Um der heutigen komplexen Bedrohungslage gerecht zu werden, sind es gerade nicht einzelne Instrumente, die besonders gefordert sind, sondern ihr orchestriertes Zusammenwirken, militärisch und zivil, auf Bundes- und auf kantonaler Ebene, in gewissen Bereichen auch mittels öffentlich-privater Kooperation.
Die hybride Konfliktführung ist für mich ein zentrales Beispiel: Die Schweiz ist schon heute betroffen von Cyberangriffen, Spionage, Desinformation und Versuchen zur Sanktionsumgehung. Diese zu erkennen und abzuwehren ist tägliche Aufgabe vieler Beteiligter. Dies umfasst zivile und militärische Mittel und alle Staatsebenen. Zu Desinformation etwa spielen nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine Rolle, doch der Schutz und die Resilienz der Schweiz hängen auch stark von einer funktionierenden Medienlandschaft, der Kommunikation der Regierung und der politischen Bildung der Bevölkerung ab.
Ich bin überzeugt, dass wir angesichts der Vielschichtigkeit und Komplexität der heutigen Bedrohungen das Zusammenwirken unserer zivilen und militärischen Abwehr- und Reaktionsfähigkeiten weiter ausbauen und entwickeln müssen. Letztlich liegt die Stärke der schweizerischen Sicherheitspolitik im Verbund, im Einbezug aller relevanten Partner. Das ist unsere bewährte eidgenössische Vorgehensweise, und diese Stärke müssen wir pflegen und weiterentwickeln.
Was wird in Zukunft für die Sicherheit und den Wohlstand des Landes immer entscheidender sein?
Entscheidend wird sein, wie gut es der Schweiz gelingt, Sicherheit als gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Verbundaufgabe zu begreifen und ihre Antwort auf ein breites Spektrum kumulierter, sich überlagernder und teilweise diffuser Bedrohungen auszurichten. Angesichts des uneindeutigen Charakters von machtpolitischer Druckausübung unterhalb der Schwelle eines bewaffneten Konfliktes – womit ein Aggressor in erster Linie darauf abzielt, die Kohäsion der Gesellschaft zu schwächen und die Handlungsfähigkeit des Staates zu lähmen – ist die Fähigkeit zur Früherkennung, Beurteilung und rechtzeitigen strategischen Entscheidfindung zentral. Gleichzeitig ist es ebenso wichtig, dass wir trotz der gegenwärtig starken Bedrohungslogik die mentale Flexibilität bewahren, auch Chancen zu erkennen und zu nutzen, die sich inmitten von Krisen und Umbrüchen bieten.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten des SEPOS
Weitführende Inhate
Folio 2025 – Für eine sichere Schweiz
Sicherheit geht weit über den militärischen Bereich hinaus. Sie umfasst Themen wie die Prävention von Naturgefahren, die nachhaltige Bewirtschaftung und Versorgung mit Ressourcen, die Sicherung des Grundeigentums, die Stabilität von Infrastrukturen sowie die Information der Bevölkerung. Und in all diesen Bereichen spielen Geodaten eine zentrale Rolle.